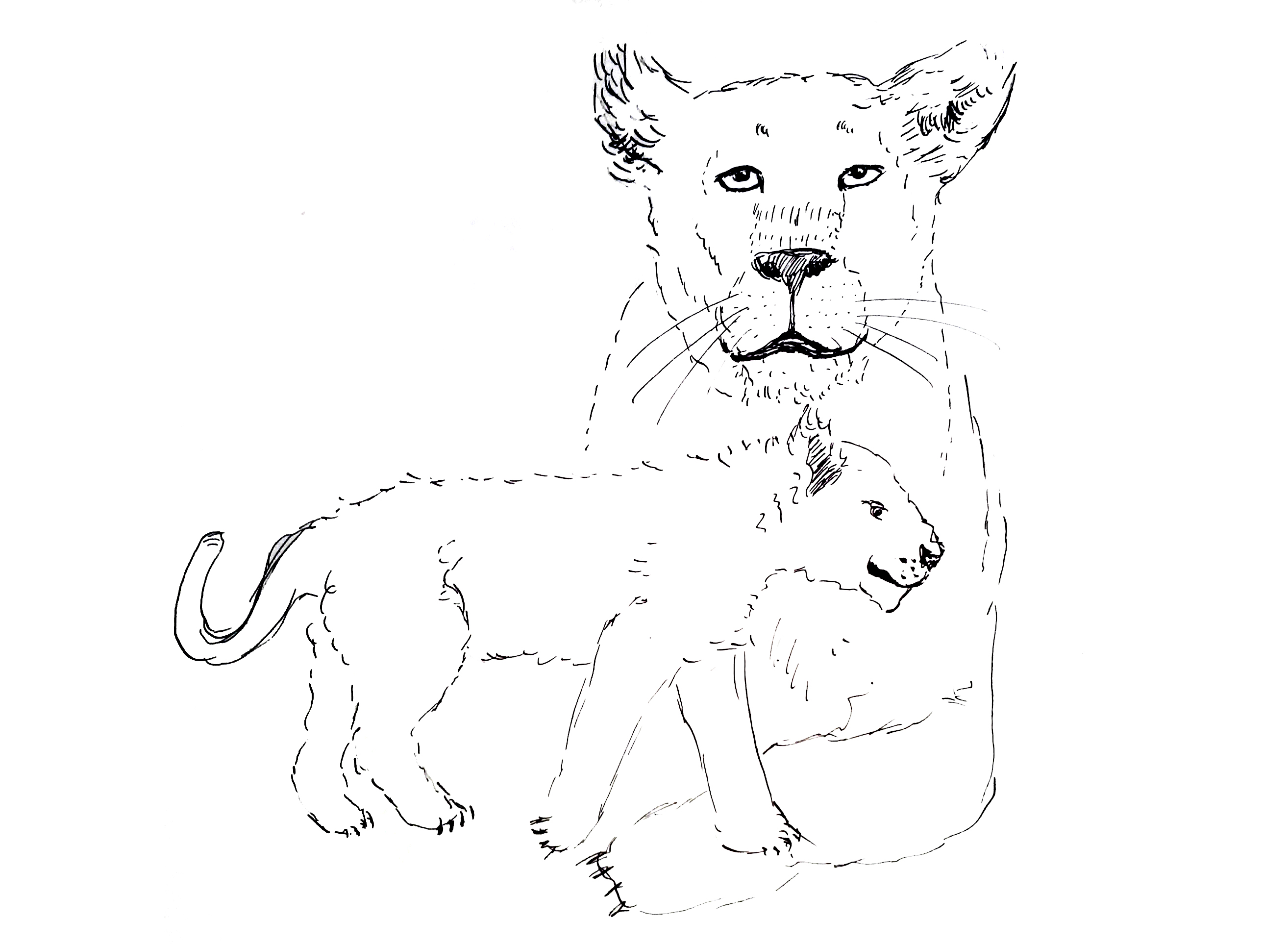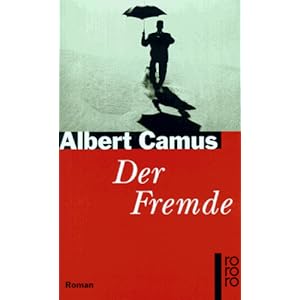Die Ermordung, Folter und Ausbeutung von Millionen Menschen in den Konzentrationslagern der Nazis ist eine Zäsur in der Geschichte der Menschheit.
Von der Ideologie der Nazis wurden Menschen zu Nicht-Menschen erklärt, und es wurden Pläne geschmiedet, diese Menschen zu ermorden. Juden, politische oder religiöse Menschen, Behinderte und psychisch Kranke sollten verschwinden.
Es scheint für die Nicht-Involvierten unbegreiflich, was sich in den Lagern abgespielt hat. Man spürt, dass man trotz der Zeugnisse der Überlebenden, der Bilder, Filme und Zeichnungen und Akten, das Ausmaß dessen, was passierte, nicht erfassen kann.
Die Überlebenden, die Zeugen, berichten oft, dass einerseits die Realität des Lagers alle anderen Erinnerungen verblassen ließ, dass Ihnen andererseits bald unvorstellbar erschien, was sie selbst erlebt hatten.
Giorgio Agamben schreibt in seinem Buch ‚Was von Auschwitz bleibt‘, dass es falsch wäre, die Geschehnisse von Auschwitz vollständig verstehen und erklären zu wollen, aber auch, jede Erklärung zu verweigern und dadurch „die Vernichtung mit dem Ansehen der Mystik“ (28) zu versehen. Auschwitz ist also weder verstehbar noch un-verstehbar. Es gibt Zeugnisse, Erkentnisse, Fakten, die verstanden werden können. Und es gibt Ungesagtes, Unsagbares, Unbezeugbares.
Was sich in den letzten Momenten in den Gaskammern abspielte, was ein Mensch wahrnahm und empfand, dessen Lebensäußerungen sich auf ein absolutes Minimum zurückgezogen hatten, das konnte nur von außerhalb bezeugt werden, nicht durch eigene Erfahrung und daher nicht vollständig.
Genau auf diese Lücke in den Zeugnissen, auf das Unbezeugbare, schaut Agamben genau.
Die Überlebenden der Lager haben Leben in unvorstellbarer Entwürdigung erlebt, das „nackte Leben, auf das der Mensch reduziert wurde, fordert nichts und gleicht sich an nichts an: es ist selbst die einzige Norm“ (60).
Viele der Lagerinsassen mussten dabei soviel ertragen, dass sie nur noch die allernötigsten Lebensäußerungen tätigen konnten, sie schienen wie lebende Tote zu sein (im Lagerjargon wurden sie Muselmänner genannt) und ihr eigentlicher Tod schien den anderen kaum mehr ein richtiger Tod zu sein. Der Tod war allgegenwärtig, in den Sterbenden, den Muselmännern, dem Fliessband-töten in den Gaskammern. Der Tod war eine Normalität, er war seiner Würde beraubt, er wurde fabriziert.
Es ist bekannt, dass Überlebende des Lagers Schuld und Scham empfinden, während die Täter oftmals Schuld und Verantwortung von sich weisen.
Die Schuldgefühle der Überlebenden erklärt Agamben mit einem Zustand der Entsubjektivierung im Lager: „Alle sterben und leben hier anstelle eines anderen, grundlos, sinnlos; das Lager ist der Ort, an dem niemand wirklich an seiner eigenen Stelle sterben oder überleben kann“ (90). In seinem Buch „Das Menschengeschlecht“ beschreibt Robert Antelme das Erröten eines Studenten, der auf einem der Todesmärsche aus dem Lager zum Erschießen ausgewählt wurde, „in der Scham hat das Subjekt einzig seine Entsubjektivierung zum Inhalt, wird es Zeuge des eigenen Untergangs, erlebt mit, wie es als Subjekt verloren geht“ (91).
Giorgo Agamben zufolge hat sich im Konzentrationslager die Bio-Macht aufs äußerste zugespitzt, in dem hier der Mensch so zugerichtet wurde, dass er ein Überlebender war, der nicht Zeugnis ablegen konnte.
Was von Auschwitz bleibt, ist zum einen die Erkenntnis, dass der Mensch, der Zeugnis ablegt für den Menschen, der nicht mehr bezeugen kann, menschlich ist, und zum anderen die Warnung, dass das Spiel am Rande der Hölle, das Spiel in der Grauzone am Rande des Überlebens noch immer in Gang ist.
Ich empfehle das Buch sehr. Außerdem empfehle ich zum Thema die Bücher „Die Vernichtung der europäischen Juden“ von Raul Hilberg, „Das Menschengeschlecht“ von Robert Antelme und „Roman eines Schicksallosen“ von Imre Kertesz.